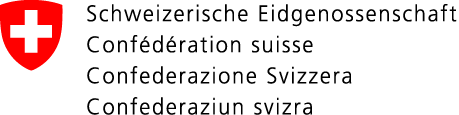FAQ - Förderung neuartiger Technologien und Prozesse
Fragen zum Förderprogramm
Welche Finanzhilfen werden ausgerichtet, wie hoch sind diese und was sind die anrechenbaren Kosten?
Mit dem Förderprogramm werden Finanzhilfen in Form von Investitionsbeiträgen und / oder jährlichen Betriebsbeiträgen ausgerichtet. Die Finanzhilfen betragen höchstens 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. Anrechenbar sind:
- für Investitionsbeiträge: die für die wirtschaftliche und zweckmässige Umsetzung der Massnahmen erforderlichen Investitionskosten. Investitionsbeiträge werden nach Umsetzung der Massnahmen ausbezahlt, wobei bei besonders kostenintensiven Massnahmen Zwischenziele mit vorzeitigen Teilzahlungen möglich sind (Art. 13, Abs. 4, Buchstabe i KlV);
- für Betriebsbeiträge: die jährlichen Betriebskosten, welche die Betriebskosten für die konventionelle Technik übersteigen. Betriebsbeiträge werden nach Umsetzung der Massnahmen während höchstens sieben Jahren, längstens bis Ende 2037 ausgerichtet (Art. 15, Abs. 2 KlV).
Wie hoch ist das Gesamtbudget der Finanzhilfe und wie ist es aufgeteilt?
Das KlG sieht Ausgaben von insgesamt maximal 1.2 Milliarden Franken für die Förderung von neuartigen Technologien und Prozessen vor, abzüglich der Mittel zur Absicherung von Risiken unter Art.7 KIG. Das BFE bestimmt im Einvernehmen mit dem BAFU die Aufteilung der Mittel auf Massnahmen zur Verminderung von Treibhausgasemissionen und auf Massnahmen zur Anwendung von Negativemissionstechnologien (NET). Dabei wird bestimmt, wie viele der Mittel für die Förderung auf Gesuch hin und wie viele für die Förderung mittels Ausschreibung eingesetzt werden.
Welche Einreichungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung?
Direkteingabe
- durch einzelne Unternehmen/Betriebsstätten (Einzeleingabe)
- durch mehrere Unternehmen/Betriebsstätten, die sich für das Gesuch um Finanzhilfe in einer gemeinsamen Eingabe zusammenschliessen (Gemeinschaft). Sie müssen eine Vertreterin oder einen Vertreter bezeichnen.
- durch Branchenverbände oder Programmträgerschaften im Auftrag von Branchenverbänden, die ein Branchenprogramm umsetzen möchten
Eingabe im Rahmen thematischer Ausschreibungen (ein- oder zweistufige Verfahren)
- für einzelne/zusammengeschlossene Unternehmen/Betriebsstätten
- für Branchen
- Das BFE informiert frühzeitig zu geplanten Ausschreibungen auf der Webseite.
Wie können Gesuche für eine Förderung eingereicht werden?
Die Gesuchsformulare für Direkteingaben von Projekten und von Branchenprogrammen sind online verfügbar. Die Übermittlung an das BFE erfolgt vorzugsweise per e-Übermittlung von Geschäften und Dokumenten. Die mittels WTO-Verfahren beauftragte externe Geschäftsstelle ITINERO prüft die Gesuche.
Kann ich mit dem Projekt beginnen, bevor mir die Finanzhilfe vom BFE per Verfügung zugesprochen worden ist?
Nein, grundsätzlich nicht, ausser das BFE hat den vorzeitigen Beginn bewilligt (siehe Kapitel 3.3.4 der Richtlinie). Im Falle vollständig ausgereifter Projekte, welche unter schwerwiegenden Nachteilen leiden würden, wenn mit dem Beginn bis zum Abschluss der Gesuchsprüfung und Zusicherung der Finanzhilfe zugewartet werden müssten, können sich Gesuchstellende über mail(at)itinero.info an das BFE wenden. Die Bewilligung für einen vorzeitigen Beginn setzt voraus dass ein vollständiges Fördergesuch beim BFE vorliegt und hat keinerlei präjudizielle Wirkung für den Anspruch auf eine Finanzhilfe (Art. 26 Abs. 2 SuG). Weiter setzt sie eine grundsätzliche Umkehrbarkeit der Investitionsverpflichtungen voraus. Der Projektant kann dann auf eigenes Risiko mit dem Projekt beginnen, bevor ihm die Finanzhilfe gewährt wird. Er trägt allfällige Kosten im Zusammenhang mit der Umkehr von Investitionsverpflichtungen. Tätigkeiten, die das Projekt nicht präjudizieren (z.B. Vorstudien, Einleitung von Bewilligungsverfahren) sind jederzeit möglich.
Was muss in einem Gesuch enthalten sein?
Das Gesuch muss die folgenden Angaben enthalten (die Details sind in Art. 13 KIV spezifiziert):
- die Art, das Anwendungspotenzial und die Wirkungsdauer der Massnahmen;
- die Entwicklungsphase, in der sich die Massnahmen befinden;
- der Umfang der angestrebten Verminderung der Treibhausgasemissionen oder der angestrebten Negativemissionen in Tonnen CO2eq;
- das Verhältnis der verminderten Tonnen CO2eq oder der erzielten Tonnen Negativemissionen zur Höhe der beantragten Finanzhilfe;
- das Risiko einer Verlagerung von Treibhausgasemissionen ins Ausland;
- die positiven und negativen Auswirkungen der Massnahmen auf die Umwelt im In- und Ausland und den Verbrauch natürlicher Ressourcen;
- die Höhe der beantragten Finanzhilfe;
- allfällige andere Förderungen und die Höhe der Eigenleistungen im Zusammenhang mit den Massnahmen;
- Zwischenziele bei besonders kostenintensiven Massnahmen;
- Namen und Kontaktangaben der zuständigen Personen.
Mit dem Gesuch ist der Netto-Null-Fahrplan (Fahrplan) einzureichen.
Werden mit den Massnahmen direkt vor- und nachgelagerte Emissionen vermindert oder wird abgeschiedenes CO2 temporär genutzt, so muss das Gesuch eine Einverständniserklärung der betroffenen Dritten zur Umsetzung der Massnahmen sowie zu den Meldepflichten enthalten.
Umfasst das Gesuch Betriebsbeiträge, ist darzulegen, wie die Massnahmen weitergeführt werden, nachdem die Finanzhilfe endet.
Was muss der Netto-Null-Fahrplan enthalten?
Fahrpläne für Unternehmen gemäss Art. 5 KlG müssen mindestens enthalten (die Details sind in Art. 3 KlV spezifiziert):
- eine Bilanzierung aller direkten und indirekten Emissionen;
- eine Beschreibung der bestehenden Anlagen und Prozesse;
- eine Analyse, mit welchen Lösungen in welchem Umfang Treibhausgasemissionen vermindert oder Negativemissionstechnologien (NET) angewendet werden können;
- die zu ergreifenden Massnahmen zur Verminderung der Treibhausgasemissionen oder zur Anwendung von NET;
- einen Absenkpfad für die direkten und indirekten Emissionen;
- einen Aufbaupfad für die Anwendung von NET, mit denen die Treibhausgasemissionen, die mit den Massnahmen nicht vermindert werden können, im In- und Ausland bis spätestens 2050 ausgeglichen werden.
Mein Unternehmen (oder meine Branche) verfügt bereits über einen Fahrplan. Kann dieser für einen Antrag auf Förderung nach Art. 6 KlG verwendet werden?
Der Fahrplan ist Teil des Gesuchs und muss den Anforderungen der Klimaschutzverordnung und den zugehörigen Richtlinien entsprechen. Die Grundlagen und die Methodik für die Erstellung eines individuellen Fahrplans oder eines Branchenfahrplans sind in der Richtlinie zu Art. 5 KlG beschrieben. Notwendige Anpassungen und Ergänzungen (z. B. Emissionsfaktoren, Grundlagen für die Berechnung von Pfaden oder der Wirkung von Massnahmen) können auf der Grundlage der THG-Bilanzdaten des im bestehenden Fahrplan verwendeten Referenzjahres vorgenommen werden, sofern der Fahrplan weniger als fünf Jahre alt ist. Andernfalls muss der Fahrplan aktualisiert werden.
Fahrpläne, die im Rahmen des Förderprogramms von EnergieSchweiz für Fahrpläne zur Dekarbonisierung (2022-2024) gefördert wurden, erfüllen die Anforderungen nach KlV nicht automatisch. Das Unternehmen oder der Branchenverband muss also auch in diesem Fall prüfen, ob die Anforderungen erfüllt sind und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.
Muss die CO2-Bilanzierung jährlich durchgeführt werden für einen Netto-Null Fahrplan?
Ein Fahrplan muss hinreichend aktuell bleiben und regelmässig (mindestens alle 5 Jahre oder bei Änderung der Verhältnisse, z.B. Erwerb, Erweiterung, Veräusserung oder Stilllegung von Anlagen) aktualisiert werden.
Gibt es für die Bilanzierung und Berichterstattung gemäss Art. 5 KIG Tools oder relevante Standards?
Für die Bilanzierung der Treibhausgasemissionen muss die Methodik des Greenhouse Gas Protocols (GHG-Protokoll) angewendet werden. Sie finden die Details zur Erstellung eines Netto-Null Fahrplans in der Richtlinie zu Art. 5 KlG. Die Richtlinie verweist auf Grundlagen für die THG-Bilanzierung, welche das BAFU zur Verfügung stellt. Dazu zählen auch Emissionsfaktoren für direkte, indirekte sowie vor- und nachgelagerte Emissionen. Wo für die Berechnung von Scope 1 und 2 Emissionen Emissionsfaktoren vom Bund veröffentlich wurden sind diese zu verwenden, solange keine spezifischeren Daten vorliegen. Das BAFU stellt für die Bilanzierung der Emissionen ein Excel-Tool zur Verfügung, in dem die am häufigsten verwendeten Emissionsfaktoren angegeben sind. Die Emissionsfaktoren werden weiter ergänzt.
Das BFE registriert die Beratenden, welche die notwendigen Ausbildungen und Expertisen zur Erstellung von Netto-Null Fahrplänen vorweisen und veröffentlicht eine Liste der registrierten Beratenden.
Aufgrund der vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen zur Entlastung der Bundesfinanzen wird die Unterstützung für Pilot- und Demonstrationsprojekte (P+D-Projekte) spätestens ab 2027 gestrichen. Können solche Projekte stattdessen unter KlG gefördert werden?
Massnahmen der Entwicklungsphase «Demonstrationszwecke» können unterstützt werden, wenn sie auf die Verminderung von Emissionen in direkt vor- oder nachgelagerten Prozessen (Scope 3) oder die Speicherung von CO2 abzielen. Für die Verminderung von direkten und indirekten Emissionen sieht die Förderung hingegen mindestens die Entwicklungsphase «Markzulassung / Markteinführung» vor.
Nach welchen Kriterien werden die Gesuche beurteilt?
Die formellen und materiellen Anforderungskriterien sind in der Richtlinie beschrieben. Für Ausschreibungen und bei der Einreichung von Branchenprogrammen gelten gegebenenfalls abweichende Kriterien und Anforderungen, welche in den Ausschreibungsdokumenten spezifiziert werden.
In welcher Form kann ich meinen Antrag einreichen?
Gesuchsformulare im Word-Format werden auf der Website des BFE zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen und Informationen können in deutscher, französischer, italienischer oder englischer Sprache eingereicht werden. Die Verwendung mehrerer dieser Sprachen im Gesuchsdossier ist zulässig.
Kann ein abgelehntes Gesuch angepasst und wieder eingereicht werden?
Ja. Falls Sie eine Massnahme, mit der Sie an einer thematischen Ausschreibung erfolglos teilgenommen haben, wieder einreichen wollen, können Sie das Gesuch frühestens zwölf Monate nach Eingabefrist der Ausschreibung einreichen (siehe Art. 12 Abs. 4 KlV).
Wie lange dauert der bundesseitige Bewilligungsprozess?
Vom Zeitpunkt, in dem festgestellt wird, dass das Gesuch formal vollständig ist (Abschluss der Prüfung der formellen Kriterien), bis zur Bekanntgabe des Förderentscheids ist in der Regel mit drei Monaten zu rechnen.
Muss bei einem erfolgreichen Pre-Proposal zu einer zweistufigen, thematischen Ausschreibung das Full-Proposal zwingend unter der Ausschreibung eingereicht werden oder könnte es auch als Direkteingabe eingereicht werden?
Es ist empfohlen, das Gesuch über die Ausschreibung einzureichen. Eine Direkteingabe der gleichen Massnahme ist erst nach Ablauf der Sperrfrist von 12 Monaten wieder möglich.
Inhaltliche Fragen
Welche Massnahmen werden unterstützt?
Es werden neuartige Technologien und Prozesse unterstützt, die für die Verminderung von Treibhausgasemissionen oder zur Anwendung von NET in Netto-Null-Fahrplänen vorgesehen sind. Konkret heisst das:
- Massnahmen zur Verminderung von direkten und indirekten Emissionen (Scope 1 & 2).
- Massnahmen zur Verminderung von direkt vor und nachgelagerten Emissionen (Scope 3).
- Massnahmen zur Speicherung von CO2 in Produkten oder im Untergrund (CCS, CCU, NET).
Was bedeutet «neuartig»? Gibt es spezifische Anforderungen an die Technologien der verschiedenen Entwicklungsphasen und Erläuterungen zum Verfahren, wie diese Phasen bestimmt werden?
Als neuartig gelten Massnahmen, die sich in einer der folgenden Entwicklungsphasen befinden (Art. 11 Abs. 1 KlV):
- Entwicklungsphase 4 (Demonstrationszwecke): Die Massnahmen wurden noch nicht im realen Massstab getestet und umgesetzt (nur zur Verminderung von Emissionen in direkt vor- oder nachgelagerten Prozessen oder Massnahmen zur Speicherung von CO2);
- Entwicklungsphase 5 (Marktzulassung und Markteinführung): Die Massnahmen wurden in der Schweiz oder in der EU mindestens einmal im realen Massstab umgesetzt;
- Entwicklungsphase 6 (Marktdiffusion): Die Massnahmen wurden in der Schweiz bereits mehr als einmal im realen Massstab umgesetzt, es bestehen aber weiterhin nicht beherrschbare Umsetzungsrisiken..
Die Definition der Entwicklungsphasen findet sich in der Richtlinie zu Art. 6 KlG. Es liegt in der Verantwortung der Gesuchstellenden, anhand von Daten zum aktuellen Stand der Technik und des Marktes die Neuartigkeit der Massnahme bzw. der involvierten Anlagen oder Prozesse darzulegen. Damit ist zu zeigen, dass sich die Massnahme in der deklarierten Entwicklungsphase befindet, also beispielsweise welche Erfahrungen dazu bestehen, wie viele ähnliche Anlagen bereits realisiert wurden und welche Umsetzungsrisiken weiterhin bestehen. Weiter müssen überzeugende Nachweise erbracht werden, dass die spezifische Technologie ausgereift genug ist, um im industriellen Betrieb die geforderten Schwellenwerte zu erreichen. Diese Aussagen werden im Rahmen der Gesuchevaluation überprüft und die Plausibilität der gewählten Einstufung in die Entwicklungsphase bestätigt oder abgelehnt.
Gibt es spezifische Anforderungen an die Massnahmen und wenn ja, wo sind diese zu finden?
Die spezifischen Anforderungen sind in KlV Anhang 2 spezifiziert. Sie betreffen insbesondere folgende minimalen Schwellenwerte für Direkteingaben:
| |
Demonstrationszwecke |
Marktzulassung und Markteinführung |
Marktdiffusion |
| Massnahme Scope 1 & 2 |
Keine Förderung unter KlG. |
1’000 Tonnen CO2eq |
5’000 Tonnen CO2eq |
| Massnahme Scope 3 |
100 Tonnen CO2eq |
500 Tonnen CO2eq |
500 Tonnen CO2eq |
| Massnahme zur Speicherung von CO2 |
5’000 Tonnen CO2eq |
5’000 Tonnen CO2eq |
5’000 Tonnen CO2eq |
Zur Berechnung der Emissionsreduktion und Entnahme/Speicherung sind die Angaben in der Richtlinie zu Art. 5 KlG (Netto-Null-Fahrpläne) massgeblich.
Die Schwellenwerte zur Emissionsverminderung sind für mein KMU zu hoch und ausserdem haben wir nicht die Möglichkeit, einen Fahrplan zu erstellen. Wie können wir dennoch von den Finanzhilfen profitieren?
Das BFE ist sich bewusst, dass der Prozess zur Erarbeitung eines Fahrplans für kleinere Unternehmen aufwändig sein kann. Informieren Sie sich bei Ihrem Branchenverband, ob ein Branchenfahrplan vorliegt oder in Erarbeitung ist. Informieren Sie sich ausserdem, ob Ihre Branche beabsichtigt, ein Branchenprogramm einzureichen. An diesem könnten Sie je nach vorgesehenen Massnahmen im Programm teilnehmen. Informieren Sie sich ausserdem auf der BFE-Webseite über thematische Ausschreibungen. Im Rahmen von thematischen Ausschreibungen können abweichende Schwellenwerte vorgegeben werden, welche für Sie interessant sein könnten.
Verstehen sich die Schwellenwerte für Branchenprogramme (Anhang 2, Ziffer 4 KlV) als kumulierte Einsparung über einen Zeitraum von 5 Jahren?
Nein, es handelt sich um eine jährliche Einsparung, die spätestens fünf Jahre nach Umsetzung der ersten unterstützten Massnahme des Branchenprogramms pro Jahr erreicht werden muss. Es gelten die Schwellenwerte gem. Anhang 2 Ziffern 1-3 KlV.
An wen richten sich Branchenprogramme?
Branchenverbände mit einem Branchenfahrplan können Gesuche für Branchenprogramme einreichen. Die Teilnahme an Branchenprogrammen richtet sich an KMU, die weniger als 250 Mitarbeitende beschäftigen, einen jährlichen Wärmeverbrauch von höchstens 5 Gigawattstunden und einen jährlichen Elektrizitätsverbrauch von höchstens einer halben Gigawattstunde haben.
Werden auch Massnahmen unterstützt, deren Umsetzung bereits anderweitig unterstützt wird?
Nein, für Massnahmen, die bereits anderweitig eine Förderung vom Bund erhalten oder in ein Instrument zur Verminderung der Treibhausgasemissionen eingebunden sind, werden in der Regel keine Beiträge ausgerichtet. Den Betreibern von Anlagen und Luftfahrzeugen, die am EHS teilnehmen, wird eine Finanzhilfe nur ausgerichtet, wenn sie glaubhaft und nachvollziehbar darlegen, dass die Kosten für die Umsetzung der Massnahmen auch langfristig unverhältnismässig hoch sind und die Massnahmen ohne Finanzhilfe nicht umgesetzt würden. Die Betreiber von Anlagen mit einer Verminderungsverpflichtung können Finanzhilfen erhalten, wenn sie glaubhaft und nachvollziehbar darlegen, dass sie ihre Verminderungsverpflichtung auch ohne Berücksichtigung der Wirkung der geförderten Massnahmen einhalten.
Carbon Capture und Storage: Was ist eine dauerhafte Speicherung?
Die Anforderungen an die Permanenz der dauerhaften Speicherung, dem Ausweisen von Leckagen und der Berichterstattungspflicht orientieren sich am Anhang 19 der teilrevidierten CO2-Verordnung zur Speicherung und chemischen Bindung von CO2. So muss für Massnahmen in Anlagen im EHS oder mit einer Verminderungsverpflichtung die geologische Speicherung in einer in der Schweiz genehmigten und im Grundbuch eingetragenen Speicherstätte oder in einer nach der Richtlinie 2009/31/EG genehmigten Speicherstätte im Ausland erfolgen.
Im KlG steht, dass Emissionsverminderungen «soweit möglich» in der Schweiz erreicht werden sollen (Art. 3, Abs. 4 KlG). Werden auch Massnahmen im Ausland unterstützt?
Unternehmen müssen Verminderungsmassnahmen grundsätzlich in der Schweiz vornehmen. Die Förderung von Massnahmen zur Verminderung von Scope 3-Emissionen im Ausland ist denkbar, wenn das Unternehmen dem BFE darlegt, dass alle nachfolgenden Punkte erfüllt sind:
- Das Schweizer Unternehmen hat gemäss seinem Fahrplan mögliche neuartige Massnahmen in der Schweiz soweit möglich ausgeschöpft (Art. 3 Abs. 4 KlG);
- Die Massnahme betrifft einen Prozess, der dem Schweizer Unternehmen direkt vor- oder nachgelagert ist;
- Scope 3 ist im Fahrplan des Unternehmens abgebildet (Emissionsbilanz, Absenkpfad und Massnahmenplan);
- Die Verminderung im Ausland ist dauerhaft und kann durch das Schweizer Unternehmen gesteuert werden. Dies ist gegeben, wenn das ausländische Unternehmen dem Schweizer Unternehmen gehört oder von diesem rechtlich beherrscht wird; oder das Schweizer Unternehmen faktisch auf das ausländische Unternehmen Einfluss ausüben kann, weil es z.B. ein Hauptabnehmer von diesem ist;
- Die übrigen Voraussetzungen gemäss KlG und KlV für die Förderung sind erfüllt.
Sollte sich im Vollzug zeigen, dass die Förderung von Massnahmen im Ausland gegenüber der Förderung von Massnahmen in der Schweiz überhandnehmen, wird die Förderpraxis entsprechend angepasst.
Kann eine Gruppe von Unternehmen als Zusammenschluss ein Gesuch einreichen, um in ihren jeweiligen Produktionsprozessen eine Massnahme umzusetzen und gemeinsam die erforderlichen Schwellenwerte zu erreichen?
Das Gesetz sieht eine finanzielle Unterstützung für die Umsetzung von Einzelmassnahmen oder - im Falle eines Zusammenschlusses – von Bündeln voneinander abhängiger Massnahmen vor. Die parallele Durchführung mehrerer identischer, aber in der Umsetzung und im Betrieb voneinander unabhängiger Massnahmen erfüllt die Kriterien eines Zusammenschlusses nicht.
Falls an einem Projekt mehrere Unternehmen beteiligt sind, müssen dann alle beteiligten Unternehmen einen Netto-Null-Fahrplan einreichen?
Alle Unternehmen, die sich für die Umsetzung einer Massnahme zusammenschliessen und deren Treibhausgas-Bilanz massgeblich durch die Massnahme beeinflusst wird (vor allem Treibhausgas-Quellen), müssen einen Fahrplan erarbeiten und einreichen.
Wenn aus einer Anlage nur ein Teil des freigesetzten CO2 abgeschieden wird und dieser Teil kleiner ist als der Anteil des gesamtheitlich emittierten, biogenen CO2, kann das abgeschiedene CO2 als 100 % biogen angesehen werden?
Nein. Der biogene Anteil einer Teilabscheidung von CO2 entspricht immer dem nachgewiesenen biogenen Anteil aus dem gesamten Abgasstroms. Das abgeschiedene CO2 enthält also das gleiche Verhältnis von biogenem und fossilem CO2 wie der gesamte Abgasstrom der Anlage, dessen Zusammensetzung im Rahmen des Monitorings / Reportings entweder durch die Bestimmung der biogenen und fossilen Anteile der Inputstoffströme oder durch eine Analyse des biogenen Anteils im Abgas effektiv nachgewiesen werden muss.
Kann ein Unternehmen die Finanzhilfe für den Kauf von CO2-Zertifikaten nach freiwilligen Standards (z.B. Zertifikate für Negativemissionstechnologien) oder Herkunftsnachweisen (z. B. für Biogas) in Anspruch nehmen?
Ein herkömmlicher Kauf von CO2-Zertifikaten nach freiwilligen Standards ist nicht förderfähig. Negativemissionen, die nicht im Unternehmen erzeugt werden, müssen in Form von nationalen und internationalen Bescheinigungen nach CO2-Gesetz beschafft werden. Zudem muss ein Zusammenhang zwischen dem Unternehmen, das Bescheinigungen benötigt, und dem Projekt, das NETs generiert, bestehen. Aus den Gesuchsinformationen muss eindeutig hervorgehen, dass das gesuchstellende Unternehmen massgeblich in die Entwicklung des NET-Projekts involviert ist, d.h. einen Einfluss auf die Entwicklung und den Betrieb der Massnahme ausüben kann. Dazu ist die Bildung eines Zusammenschlusses von Unternehmen möglich.
Eine herkömmliche Substitution von Erdgas durch Biogas ist ebenfalls nicht förderfähig, da es sich hierbei nicht um einen innovativen Ansatz handelt. Die Mehrkosten sind daher nicht anrechenbar. Für eine Unterstützung denkbar wäre der Bau einer neuartigen Biogasanlage (oder einer Anlage für ein erneuerbares synthetisches Gas) für die Erreichung des Netto-Null-Ziels eines Schweizer Unternehmens, das massgeblich in die Projektentwicklung involviert ist.
Fragen zu den Teilnahmebedingungen
Wer ist zur Gesuchseingabe zugelassen?
Die Finanzhilfen richten sich schwerpunktmässig an treibhausgasintensive Unternehmen und Betriebsstätten als Anwender neuartiger Technologien, resp. neuartiger Prozesse, die der Umsetzung ihrer Netto-Null-Fahrpläne gemäss Art. 5 KlG oder einzelner Massnahmen davon dienen. Zugelassen sind Unternehmen oder Branchen mit einem individuellen Fahrplan resp. Branchenfahrplan gemäss KlG Art. 5. Ein vollständiger Fahrplan ist Teil des Fördergesuchs. Bis zum 30. September 2025 können bestehende Fahrpläne, die nicht der Methodik der Richtlinie Art. 5 entsprechen, provisorisch eingereicht werden. Für eine definitive Zusage müssen die Fahrpläne bis Ende September 2025 ggf. entsprechend der Richtlinie angepasst und eingereicht werden. Bei Ausschreibung ist den jeweiligen Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen, wer zugelassen ist.
Wer erhält die Förderung im Fall eines Zusammenschlusses von Unternehmen?
Mehrere Unternehmen, die gemeinsam ein Gesuch einreichen, müssen für den Kontakt mit dem BFE bzw. der Geschäftsstelle einen Vertreter ernennen (Art. 13 Abs. 2 KlV). Im Gesuch ist ausserdem darzulegen, an welches Unternehmen die Finanzhilfe ausbezahlt werden soll.
Können Hersteller von erneuerbaren Energien (z.B. Wasserstoff oder synthetische Brennstoffe) einen Investitionsbeitrag vom KlG erhalten?
Es ist möglich, dass sich ein Unternehmen als Anwender eines Produkts oder Energieträgers für die Umsetzung von Massnahmen mit einem Hersteller und/oder einem Lieferanten zusammenschliesst, sofern der Anwender das Gesuch einreicht und der Empfänger der Finanzhilfe ist. So können sich zum Beispiel Unternehmen, die mit innovativen Massnahmen fossile Energieträger substituieren, mit Betreibern von Produktions- und Speicheranlagen von erneuerbarem Wasserstoff und erneuerbaren synthetischen Energieträgern in der Schweiz zusammenschliessen. Der Anwender/Endverbraucher (Unternehmen) muss dabei die vorgesehene Massnahme mit der entsprechenden Emissionsreduktion in seinem Netto-Null-Fahrplan aufführen.
Können Betreiber von Anlagen und Luftfahrzeugen, die am Emissionshandelssystem teilnehmen, auch Unterstützung erhalten?
Nur, wenn sie glaubhaft und nachvollziehbar darlegen, dass die Kosten für die Umsetzung der Massnahmen auch langfristig unverhältnismässig hoch sind und die Massnahmen ohne Finanzhilfe nicht umgesetzt würden.
Können Betreiber mit einer Verminderungsverpflichtung nach CO2-Gesetz Art. 31 und 31a (CO2-Abgabebefreiung) auch Unterstützung erhalten?
Nur, wenn sie glaubhaft und nachvollziehbar darlegen, dass sie ihre Verminderungsverpflichtung auch ohne Berücksichtigung der Wirkung der geförderten Massnahmen einhalten.
Innovative Anlagen zur Umwandlung von erneuerbarer Elektrizität in Wasserstoff, synthetische Gase, Brenn- oder Treibstoffe ohne Rückspeisung dürfen unter gewissen Bedingungen gemäss Bundesgesetz über die Stromversorgung ab dem 01.01.2026 eine Rückerstattung des Netznutzungsentgeltes beantragen (siehe Art. 14a, Abs. 4, Buchstabe c StromVG, SR 734.7). Darf diese Rückerstattung mit einer Förderung KlG für neuartige Technologien kumuliert werden?
Die Rückerstattung des Netznutzungsentgeltes stellt eine Subvention dar. Das Klimaschutzgesetz sieht vor, dass keine Förderung ausgerichtet wird für Massnahmen, die bereits anderweitig eine Förderung erhalten (Art. 6 Abs. 4 KlG, SR 814.310). Eine Anlage kann also nicht mit beiden Instrumenten unterstützt werden.
Ist eine parallele Beteiligung an einer Direkteingabe, an einer Ausschreibung und/oder an einem Branchenprogramm zulässig?
Einzelne Massnahme können nicht mehrfach gefördert werden. Gesuche können parallel über verschiedene Kanäle eingereicht werden. So können Sie zum Beispiel an einer Ausschreibung teilnehmen, auch wenn Sie bereits ein Gesuch als Direkteingabe deponiert haben. Wenn Sie hingegen für eine Massnahme an einer Ausschreibung teilgenommen haben, so können Sie für diese Massnahme frühestens 12 Monate nach der für die Ausschreibung festgelegten Eingabefrist ein Gesuch einreichen (siehe Art. 12 KIV).
Kann eine Massnahme von der Förderung profitieren und gleichzeitig internationale Bescheinigungen oder Bescheinigungen für Emissionsverminderungen im Inland beantragen?
Die Bescheinigungen können kompensationspflichtigen Treibstoffimporteuren (z.B. Branchenübergreifende Kompensationsgemeinschaft KliK) verkauft werden. Eine Massnahme, für die internationale Bescheinigungen oder Bescheinigungen für Emissionsverminderungen im Inland ausgestellt werden, ist in der Regel von der Förderung ausgeschlossen. Nur wenn das Unternehmen dem BAFU darlegen kann, dass diese Bescheinigungen nicht zur Erfüllung der Kompensationspflicht und nicht zur Einhaltung der Verminderungsverpflichtung verkauft werden, kann diese Massnahme gefördert werden.
Sind öffentliche Institutionen wie Spitäler, Energieversorgungsunternehmen, Transportunternehmen für den öffentlichen Verkehr, Städte etc. förderberechtigt?
Ja, grundsätzlich sind auch öffentlich-rechtliche Körperschaften förderberechtigt für Finanzhilfen gemäss KlG Art. 6, sofern es sich um freiwillige Massnahmen im Rahmen eines Netto-Null Fahrplans handelt und diese nicht in Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht (z.B. auf Grund des Umweltschutzgesetzes) geschieht.
Fragen zur Umsetzung der Massnahmen
Bis wann müssen die Massnahmen umgesetzt werden und wie lange werden die Betriebsbeiträge ausgerichtet?
Die Massnahmen müssen spätestens am 31. Dezember 2035 umgesetzt sein.
Betriebsbeiträge werden während höchstens 7 Jahren ausgerichtet, längstens jedoch bis am 31. Dezember 2037.
Wie gestalten sich die Auszahlung der Finanzhilfe und die Berichterstattung?
Nach der Inbetriebnahme der Massnahmen oder, bei besonders kostenintensiven Massnahmen, nach der Erreichung eines Zwischenziels ist dem BFE ein Umsetzungsbericht einzureichen. Er bildet die Grundlage für die Auszahlung der Finanzhilfe. Bei Investitionsbeiträgen gilt: 10 Prozent der Finanzhilfe werden zurückbehalten, bis der später folgende Evaluationsbericht genehmigt worden ist. Drei Jahre nach der Inbetriebnahme der Massnahmen ist dem BFE ein Evaluationsbericht einzureichen. Er gibt Auskunft über die mittelfristige Wirkung der geförderten Massnahmen, insbesondere über die jährlichen Verminderungen von Treibhausgasemissionen bzw. die jährlich erzielten Negativemissionen in den letzten drei Jahren. Die restlichen 10 Prozent der Investitionsbeiträge werden nach der Genehmigung des Evaluationsberichts ausbezahlt. Bei Betriebsbeiträgen muss für die Auszahlung der Finanzhilfe ab Inbetriebnahme der Massnahmen am Ende jedes Geschäftsjahres ein Bericht mit den Belegen der Betriebskosten eingereicht werden.
Was passiert, wenn sich in den Rahmenbedingungen etwas ändert, sodass eine Massnahme nicht weiter umgesetzt werden kann?
Das BFE muss vom Gesuchsteller unverzüglich über jede Änderung informiert werden, die die Gewährung oder die Höhe der Finanzhilfe beeinflussen könnte. Dies gilt ab Einreichung des Gesuchs bis zur Genehmigung des Evaluationsberichts, der drei Jahre nach der Inbetriebnahme der Massnahme einzureichen ist.
Wird eine Nichteinhaltung von Verpflichtungen festgestellt, erfolgt eine Mahnung. Erfüllen die Gesuch-stellenden ihre Verpflichtungen trotz Mahnung nicht oder nur mangelhaft, so wird die Finanzhilfe nicht oder nur teilweise ausbezahlt oder zurückgefordert (vgl. Art. 28–30 SuG). Die Finanzhilfe kann zudem anteilsmässig zurückgefordert werden, wenn eine mit einer geförderten Massnahme zusammenhängende Verpflichtung nicht fristgemäss oder nicht umgesetzt wurde. Auch bereits bezahlte Betriebsbeiträge, die nicht als Betriebskosten angefallen sind, können zurückgefordert werden.