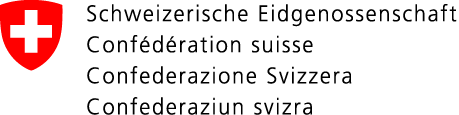FAQ - Stromabkommen Schweiz – EU
Allgemeines
Wozu braucht es überhaupt ein Stromabkommen? Die Schweiz hat doch die Energiekrise unbeschadet überstanden, nationale Stromreserven aufgebaut und den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigt.
Ist das Stromabkommen aus Sicht des Bundesrates ein Trumpf oder eine Last?
Marktöffnung und Grundversorgung
Was bedeutet die ausgehandelte Strommarktöffnung in der Schweiz für die Konsumentinnen und Konsumenten?
Was bedeutet die Strommarktöffnung für die Stromproduzenten?
Endverbraucher können bei tiefen Preisen frei in den Markt wechseln und bei hohen Preisen zurück in die Grundversorgung – kann so die Grundversorgung funktionieren?
Mit dem Stromabkommen hat die Schweiz ein Recht, eine regulierte Grundversorgung mit regulierten Preisen einzuführen. Damit das System funktioniert, ist die Grundversorgungsregulierung (bspw. hinsichtlich Tariffixierung von einem Jahr) mit den geltenden Wechselfristen und regulierten Wechselgebühren abzustimmen.
Welcher Spielraum hat der Bundesrat bei der Festlegung der Verbrauchsschwelle für die Berechtigung für Haushalte und Unternehmen zum Verbleib oder zur Rückkehr in die Grundversorgung?
Bei der Festlegung der Verbrauchsschwelle besteht ein gewisser Interpretationsspielraum. Mit Blick auf die Bestimmung in Art. 7, Abs. 1 Stromabkommen und das relevante EU-Recht (Art. 27 und Art. 5 EU-Strombinnenmarktrichtlinie EU/2019/944) scheint eine Schwelle von 50 MWh angemessen. So ist gemäss Art. 5 EU-RL 2019/944 eine Tarifregulierung nur für Haushalte und Kleinstunternehmen zulässig, die in der EU definiert sind als Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitenden und einem Umsatz oder einer Bilanzsumme von weniger als 2 Millionen Euro. In der Kundengruppe zwischen 50 und 100 MWh befinden sich bspw. kleine Bäckereien, kleine Druckereien, Geschäfte wie kleinere Coop/Migros Filialen, Hotels und Schulen. Viele dieser Stromverbraucherinnen und -verbraucher dürften nicht in die EU-Definition von Kleinstunternehmen fallen, womit die Beibehaltung der Schwelle bei 100 MWh nicht konform mit dem Stromabkommen wäre.
Es gilt zu betonen, dass heute in der Schweiz nur rund ein Drittel der Energielieferung an Unternehmen zwischen 50 und 100 MWh noch zu Gestehungskosten geliefert werden. Das entspricht einer gesamten Strommenge von ca. 600 GWh oder 1% des Stromendverbrauchs, noch zu Gestehungskosten geliefert werden, womit die jeweiligen Unternehmen von einem gewissen Schutz vor Marktpreisen profitieren. Diese Energiemenge würde unter dem Stromabkommen neu über den Markt beschafft. Die anderen zwei Drittel werden von Energieversorgungsunternehmen ohne Eigenproduktion geliefert, die bereits heute am Markt beschafft werden, womit die Grundversorgung für sie keinen besonderen Schutz vor Marktpreisen bietet.
Welche Auswirkungen hätte die Senkung der Verbrauchsschwelle für die Grundversorgung von 100 MWh auf 50 MWh?
Aufgrund der verfügbaren Daten ist es schwierig, detaillierte Angaben über die Auswirkungen der Absenkung der Verbrauchsschwelle für die Grundversorgung von 100 MWh auf 50 MWh zu machen. Gemäss Zahlen aus den Energiestatistiken des Bundesamtes für Energie (BFE) und einer Umfrage der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (ElCom) bei den Grundversorgern wären von der Absenkung rund 6 % der Verbrauchsstätten respektive rund 20'000 Betriebe mit einem gesamten Stromverbrauch von unter 2 TWh (= 3 % des Schweizer Endverbrauchs) betroffen. Rund zwei Drittel dieses Stromverbrauchs (entsprechend rund 1'300 GWh) werden bereits heute von Grundversorgern ohne Eigenproduktion am Markt beschafft, womit diese Kunden heute keinen speziellen Schutz vor Marktpreisen geniessen. Der Stromverbrauch dieser Kundengruppe, der mit dem Stromabkommen neu am Markt beschafft würde, umfasst damit weniger als 600 GWh (1 % des Schweizer Endverbrauchs). Diese Kundengruppe zwischen 50 und 100 MWh hat mit dem Stromabkommen keinen Anspruch mehr auf die Grundversorgung, sie kann aber neu ihren Lieferanten und das gewünschte Stromprodukt hinsichtlich Laufzeit, Herkunft, ökologischer Qualität, Flexibilität des Stromverbrauchs oder Preisstabilität aus einer grossen Anzahl an Angeboten im Markt auswählen.
Die Wechselfristen nach EU-Recht sollen nach einer dreijährigen Übergangsfrist auch in der Schweiz gelten. Ist entsprechend damit zu rechnen, dass eine Wechselfrist von 24 Stunden auch für die Schweiz gelten wird?
Nein. Es gilt zu unterscheiden zwischen Wechselfrist und Dauer des technischen Prozesses für den Lieferantenwechsel. Art. 12 der EU-Strombinnemarktrichtlinie 2019/944 besagt, dass wechselwillige Kunden unter Vorbehalt von anderslautenden Vertragsbedingungen innert drei Wochen wechseln können. Im Markt dürfen aber weiterhin längere Kündigungsfristen vorgesehen werden. Ab 2026 darf der technische Prozess zum Lieferantenwechsel gemäss EU-Stromrichtlinie zudem nicht länger als 24 Stunden dauern und muss an jedem Arbeitstag möglich sein. Die Schweiz hat unter dem Stromabkommen eine Verpflichtung, diese Bestimmungen nach einer dreijährigen Übergangsfrist ebenfalls umzusetzen.
Mit welchen Massnahmen werden Endverbraucherinnen und Endverbraucher vor Marktmissbrauch geschützt?
In der Schweiz gibt es aktuell ca. 580 Verteilnetzbetreiber/Grundversorger. Dies ist eine gute Basis, damit nach der Marktöffnung ein funktionierender Wettbewerb mit einer grossen Auswahl an Produkten entstehen kann. Mit der Umsetzung der vollständigen Strommarktöffnung werden folgende Begleitmassnahmen zum Schutz der Endverbraucher geregelt:
- Möglichkeit für Haushaltskunden und KMU zum Verbleib oder zur Rückkehr in die regulierte Grundversorgung;
- Regelung einer Ersatzversorgung für Kunden, deren Lieferant ausfällt oder die nicht rechtzeitig einen neuen Lieferanten wählen;
- Gewährleistung einer elektronischen Vergleichsplattform für Stromangebote von Lieferanten;
- Mindestvorgaben an Vertragsinhalte und Verbot von missbräuchlichen Vertragspraktiken;
- Vorgaben für Produktangebot für grosse Stromlieferanten (Liefervertrag mit Festpreis und Laufzeit von mindestens einem Jahr, Liefervertrag mit dynamischen Strompreisen für Endverbraucherinnen und Endverbraucher mit Smart Meter);
- Pflichten für Stromlieferanten (Registrierung bei der Elcom, Betrieb eines Kundendiensts in der Schweiz, Einführung eines Risikomanagements);
- Schlichtungsstelle/Ombudsstelle, die Endverbraucherinnen und Endverbraucher über Rechte informiert und bei Streitigkeiten vermittelt;
- Monitoring der wirtschaftlichen Entwicklung im Markt und in der Grundversorgung durch die ElCom. Gestützt darauf können die Massnahmen nötigenfalls angepasst werden oder weitergehende Massnahmen getroffen werden.
Was passiert mit dem ab 1.1.2026 geltenden Anteil von 20% erneuerbarer Energien in der Grundversorgung aus inländischer Produktion?
Der Mindestanteil von 20% erneuerbarer Energien in der Grundversorgung soll beibehalten werden. Die Bedingung für die Produktion im Inland soll gestrichen werden, da sie im EU-Strombinnenmarkt potenziell diskriminierend ist.
Entflechtung
Welche Schweizer Verteilnetzbetreiber sind von den zusätzlichen Entflechtungsvorschriften betroffen?
Mit der Umsetzung des Stromabkommens würden in der Schweiz, zusätzlich zu den bestehenden Regeln für eine buchhalterische und informatorische Entflechtung, neu Regeln für eine rechtliche und organisatorische Entflechtung von Verteilnetzbetreibern gelten. Davon betroffen sind grosse Verteilnetzbetreiber mit mehr als 100'000 angeschlossenen Kunden sowie kleinere Verteilnetzbetreiber, die von grossen Verteilnetzbetreibern kontrolliert werden. Gemäss einer ElCom-Umfrage von 2024 wären die folgenden 17 Verteilnetzbetreiber von den zusätzlichen Vorgaben betroffen:
- EKZ, BKW, La Goule, SIG, Romande Energie, Groupe E, ewz, CKW, ews, Steiner Energie, IWB, SiL, Oiken, Primeo, AVAG, AEW, AIL.
Der Rücklauf bei der Umfrage war hoch aber nicht vollständig. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Verteilnetzbetreiber von den zusätzlichen Vorschriften betroffen sind oder dass gewisse der genannten Verteilnetzbetreiber aufgrund zwischenzeitlich geänderter Umstände nicht mehr von den Vorschriften betroffen sind.
Eine zusätzliche Entflechtung, die alle Verteilnetzbetreiber betrifft, also nicht nur diejenigen über der Schwelle von 100'000 Kunden, wird hinsichtlich Speicher und Ladestationen für Elektrofahrzeuge verlangt. Verteilnetzbetreiber dürfen grundsätzlich keine Speicher und Ladestationen für Elektrofahrzeuge besitzen oder betreiben. Ausnahmen sind möglich, wenn man Ausschreibungsverfahren durchführt und diese nicht zur Zuteilung an andere Personen führen. Das heisst aber nicht, dass Speicher und Ladestationen für Elektrofahrzeuge an Dritte veräussert werden müssen. Sie können innerhalb des Elektrizitätsversorgungsunternehmen bleiben so lange sie nicht bei der Netzsparte (Verteilnetzbetreiber) sind.
Netze und Versorgungssicherheit
Wird die Stromversorgung stabiler?
Darf die Schweiz weiterhin Reserven bauen?
Welche Sicherheit hat die Schweiz, dass die EU die Schweiz bei Strommangel nicht doch abhängt?
Kann davon ausgegangen werden, dass die Betreiber von Reservekraftwerken im Krisenfall vorab den einheimischen Markt aus diesen inländischen Reserven versorgen?
Allfällig notwendige Stromreserven werden für die Schweiz gebaut. Sie werden bei Versorgungsproblemen in der Schweiz eingesetzt. Die im Sommer 2025 vom Parlament beschlossenen Änderungen des Stromversorgungsgesetzes (StromVG) sehen eine Möglichkeit vor, die Reserven auch bei Versorgungsproblemen in Nachbarstaaten einzusetzen. Dies ist auch unter dem Stromabkommen möglich. Das Abkommen verpflichtet die Schweiz aber nicht, die Reserven bei Mangellagen im Ausland zu aktivieren. Die heutige Vorgabe, die den Verkauf ins Ausland verbietet, kann in der Praxis bereits heute nur schwer durchgesetzt, resp. kontrolliert werden, da die Reserveanbieter genügend Möglichkeiten haben, die entsprechenden Mengen in ihrem Portfolio zu vermischen. Dieses Verbot wird daher gestrichen. Zudem wird es mit der Marktkopplung unter dem Stromabkommen systembedingt nicht mehr möglich sein Strom aus inländischen Reserven direkt ins Ausland zu verkaufen. Dies weil die Grenzkapazitäten mit der Marktkopplung dem Marktergebnis zugeordnet werden und nicht mehr von den (Reserve-)Produzenten ersteigert werden können.
Gilt die EU-Vorgabe, wonach 70 % der für den grenzüberschreitenden Stromhandel relevanten Netzkapazitäten dem Handel zur Verfügung zu stellen sind, auch für die Schweiz?
Ja. Dies gilt auch für die Schweiz. Gemäss den Informationen, die das BFE hat, ist die Umsetzung der Vorgabe für die Schweiz möglich und unproblematisch. Mit dem Stromabkommen hat die Schweiz eine rechtliche Absicherung, dass die Schweiz bei der Umsetzung der Regel voll einbezogen wird und dass die Regel nicht einseitig gegen sie ausgelegt werden kann, um z.B. Grenzkapazitäten Richtung Schweiz einzuschränken.
Schweizer Stromversorgungsunternehmen haben mit Electricité de France (EDF) langfristige Lieferverträge für Strom aus Kernenergie. Fallen diese mit dem Abkommen weg? Gibt es negative Auswirkungen auf die Sicherheit der Stromversorgung in der Schweiz?
Nein. Die langfristigen Lieferverträge mit Frankreich, also die Stromlieferungen als solche, sind vom Stromabkommen nicht infrage gestellt. Nur die Vorränge beziehungsweise Reservierungen, dank denen Stromlieferungen bei der Zuteilung von Kapazitäten im grenzüberschreitenden Übertragungsnetz vorab bedient werden, werden mit Inkrafttreten des Stromabkommens entfallen. Dafür erhalten die Vertragshalter während einer Übergangszeit von grundsätzlich sieben Jahren eine finanzielle Entschädigung. Da nur die Einspeisevorränge, nicht aber die Lieferverträge wegfallen, da die Schweizer Vertragshalter die entsprechende Energie bereits seit mehreren Jahren auch direkt in Frankreich absetzen können sowie auch mit der Erstellung des liquiden EU-Strombinnenmarktes hat die Bedeutung der Einspeisevorränge und Lieferverträge für die Schweizer Versorgungssicherheit in den letzten Jahren stark abgenommen.
Erneuerbare Energien und Wasserkraft
Wären die Beihilfen zur Förderung der erneuerbaren Energien bei einem Stromabkommen nicht mehr zulässig? Würde das den Ausbau hindern?
Was bedeutet das Stromabkommen für das Recht der Kantone zur Vergabe der Konzessionen für die Wasserkraft?
Warum wird die Schwelle für die Abnahme- und Vergütungspflicht in Art. 15 des Energiegesetzes (EnG) von 3 Megawatt (MW) auf 200 Kilowatt (kW) abgesenkt?
Gemäss Art. 5 EU-Strommarktverordnung sollen Anlagen über 200 kW Bilanzverantwortung tragen, d.h. sie sollen finanzielle Anreize haben, sich netzdienlich zu verhalten. Bei Anlagen, die von der Abnahme- und Vergütungspflicht profitieren, ist dies nicht der Fall. Deswegen wird die Schwelle auf 200 kW abgesenkt. Anlagen zwischen 200 kW und 3 MW müssen sich demnach neu einen Direktvermarkter suchen. Anlagen ab 200 kW sind grosse Anlagen, die professionell betrieben werden. Für sie ist es zumutbar, dass sie neu einen Vertrag mit einem Direktvermarkter abschliessen.
Warum erfolgt bei der Vergütungspflicht der Wechsel von einem quartalsweise gemittelten Marktpreis zu einem stündlichen (day-ahead-)Marktpreis?
Mit einem quartalsweise gemittelten Marktpreis können bei den Abnahmepflichtigen aufgrund der unterschiedlichen Produktionsprofile der erfassten Anlagen ungedeckte Kosten entstehen. Heute können diese Kosten zumindest teilweise über das Monopol in der Grundversorgung refinanziert werden, was mit der Marktöffnung für alle Endverbraucherinnen und Endverbraucher nicht mehr zwingend möglich ist. Deshalb soll sich die Vergütung neu an den aktuellen Marktpreisen orientieren. Bei negativen Marktpreisen erfolgt jedoch keine Vergütung. Die negativen Marktpreise werden also nicht an die Anlagen unter 200 kW weitergegeben.
Mit dem Stromabkommen werden die wichtigsten Schweizer Beihilfen für erneuerbare Energien für 6 bzw. 10 Jahre befristet als konform mit dem EU-Binnenmarkt erklärt. Ist in der EU eine Tendenz zu beobachten, womit solche Beihilfen künftig nicht mehr möglich wären? Welche Optionen stehen der Schweiz offen, um diese Unterstützungsmassnahmen völkerrechtlich oder im Landesrecht abzusichern?
Eine solche Tendenz ist in der EU nicht zu beobachten. Im Gegensatz dazu sieht das EU-Recht und das Stromabkommen in Artikel 21, Absatz 2 gerade Verpflichtungen vor, den Anteil erneuerbarer Energie im Energiesystemen zu erhöhen. Die Befristung im Abkommen ist nicht materiell bedingt, sondern prozedural, weil solche Beurteilungen in der EU generell nicht unbefristet gemacht werden. Damit besteht die Möglichkeit für eine spätere Neubeurteilung, insbesondere auch im Lichte von möglichen Änderungen des Rechtsrahmens. Eine völkerrechtliche Absicherung war in den Verhandlungen nicht möglich, ist aber auch nicht notwendig. Eine Absicherung im Schweizer Recht vorzunehmen, würde dem vereinbarten Konzept widersprechen, wonach eine unabhängige (Schweizer) Behörde für die Prüfung zuständig ist.
Sind die Wasserzinsen unter dem Stromabkommen gefährdet?
Nein. Gemäss Stromabkommen entscheidet die Schweiz eigenständig über die Bedingungen zur Nutzung der Wasserkraft. Das Wasserrechtsgesetz definiert für die Wasserzinsen ein bundesrechtliches Maximum, wobei die Kantone, als verfügungsberechtigte Gemeinwesen die Wasserzinshöhe festlegen. Daran ändert sich mit dem Stromabkommen nichts. Die Wasserzinsen als solche, sind EU-rechtlich nicht als Beihilfen, sondern als Abgaben zu betrachten. Entlastungen von dieser Abgabe können beihilferechtlich relevant sein.
Bleiben unter dem Stromabkommen Konzessionsleistungen an die öffentlichen Gemeinwesen wie Konzessionsabgaben, Gratis- oder Vorzugsenergie, Infrastrukturleistungen (bspw. Bau und Unterhalt von Brücken und Wegen) möglich?
Ja. Das Stromabkommen enthält keine materiell-rechtlichen Vorgaben für die Konzessionsvergabe und -leistungen. Sofern gewisse Stromerzeugungsanlagen in marktverzerrender Weise Entlastungen von Konzessionsleistungen erhalten, kann dies aber beihilferechtlich relevant sein.
Der Bundesrat hat in der Vernehmlassung vorgeschlagen, dass der Anspruch auf eine Minimalvergütung nach einer Übergangszeit erlöschen soll. Macht der Bundesrat diesen Schritt aufgrund einer absehbaren Inkompatibilität mit EU-Recht?
Die Minimalvergütungen sind unter dem Stromabkommen insofern problematisch, als sie Anreize zur Produktion in Negativpreisphasen gewähren. Zudem werden die Minimalvergütungen heute teilweise über das Monopol in der Grundversorgung refinanziert. Ersteres führt in einer Stromsystemsicht zu einer Negativspirale, mit der die Anzahl Stunden mit negativen Preisen weiter erhöht wird. Dies ist im EU-Recht grundsätzlich unzulässig, wobei für kleine Anlagen unter einer Leistung von 200 kW Ausnahmen geregelt werden könnten. Das Parlament hat im Herbst 2025 unabhängig vom Stromabkommen bereits beschlossen, in Negativpreisphasen keine Vergütungen mehr zu gewähren. Zweiteres ist mit der vollständigen Marktöffnung problematisch, da ohne gebundene Kunden den Grundversorgern die Finanzierungsbasis für die Minimalvergütung fehlen wird.
Der Bundesrat schlägt nach einer Übergangsfrist den Wegfall der Minimalvergütungen vor, was nicht bedeutet, dass die Einspeisung nicht mehr entschädigt wird. Es bedeutet, dass Produzenten neu Marktpreise für die eingespeiste Elektrizität erhalten, wenn sie sich nicht um andere Absatzmöglichkeiten bemühen wollen oder können. Aus Sicht des Bundesrates scheint der Schutz vor Marktpreisen mittels Minimalvergütung mittelfristig nicht mehr zwingend nötig für den rentablen Betrieb von PV-Anlagen. In der Schweiz werden PV-Anlagen zu 90% in Verbindung mit Eigenverbrauch realisiert, dieser stellt für diese Anlagen die Haupteinnahmequelle dar. Mit Blick auf die fallenden Preise für PV-Anlagen, den steigenden Stromverbrauch durch die Elektrifizierung, die starke Kostenreduktion und zunehmende Verbreitung von Speichersystemen wird die Bedeutung des Eigenverbrauchs zunehmen. Auch die bestehende regulatorische Förderung der lokalen Absatzmöglichkeiten über den Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) und die lokalen Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) begünstigt den Eigenverbrauch. Andersherum werden die Erlöse aus der Netzeinspeisung immer weniger bedeutend, weshalb den Betreibern zunehmend ein Verkauf zu Marktpreisen zugemutet werden kann.
Insgesamt ist festzuhalten, dass Minimalvergütungen per se EU-rechtlich nicht unzulässig sind. Der Bundesrat schlägt deren Abschaffung vor, da zukünftig die finanzielle Basis dafür fehlen wird, da ohne sie die Marktintegration von PV-Strom gefördert wird und den Schweizer PV-Anlagen durch den steigenden Eigenverbrauch und sinkenden Gestehungskosten alternative Absatzmöglichketen zur Verfügung stehen. Falls die Minimalvergütung weitergeführt werden soll, müsste eine neue Finanzierungsart geregelt werden. Eine Finanzierung über den Netzzuschlagsfonds ohne Erhöhung des aktuellen Zuschlags von 2,3 Rappen pro Kilowattstunde (Rp./kWh) ginge dabei zu Lasten des weiteren Ausbaus der erneuerbaren Energien.
Geltungsbereich und dynamische Rechtsübernahme
Übernimmt die Schweiz mit dem Stromabkommen Regeln in den Bereichen Stromverbrauch, Energieeffizienz oder Gebäude?
Nein. Der Geltungsbereich des Stromabkommens betrifft gemäss Art. 2 Erzeugung, Übertragung, Verteilung, Handel und Versorgung von bzw. mit Strom. Der Verbrauch von Strom ist nicht Teil des Geltungsbereichs, ebensowenig wie Fragen der Energieeffizienz oder betreffend Gebäude.
Könnten Kantone unter dem Stromabkommen auch den Stromverbrauch von lokalen Industrieunternehmen subventionieren bzw. Entlastungen vorsehen?
Ja. Die Schweiz übernimmt Beihilfebestimmungen nur im Geltungsbereich des Abkommens. Dieser betrifft lediglich Erzeugung, Übertragung, Verteilung, Handel und Versorgung von bzw. mit Strom. Für den Stromverbrauch gelten die Beihilfebestimmungen demnach nicht.
Anhang I listet die von der Schweiz im Strombereich übernommenen Rechtsakte der EU auf. Anhang IV listet die im Bereich Erneuerbare Energien übernommenen Rechtsakte auf. Sind dies abschliessende Listen?
Ja. Die von der Schweiz (mit den aufgeführten Ausnahmen und Präzisierungen) übernommenen EU-Rechtsakte sind in den Anhängen des Abkommens abschliessend aufgeführt. Die Schweiz hat unter dem Stromabkommen keine Pflicht, Bestimmungen der EU zu übernehmen, die in Rechtsakten geregelt sind, die nicht in den Anhängen aufgeführt sind. Zukünftige Änderungen der in den Anhängen aufgeführten Rechtsakte sowie allfällige neue Rechtsakte, die in den Geltungsbereich des Stromabkommens fallen, werden von der Schweiz zudem nicht automatisch übernommen. Vielmehr müssen diese per Beschluss des Gemischten Ausschusses ins Abkommen integriert werden, damit sie für die Schweiz gelten. Dieser Beschluss kann erst gefällt werden, nachdem die entsprechenden innerstaatlichen Genehmigungsprozesse dafür abgeschlossen sind. Auf der Schweizer Seite gelten diesbezüglich die üblichen Verfahren für die Genehmigung von Staatsverträgen. D.h. der Entscheid über die Übernahme eines neuen EU-Rechtaktes in das Stromabkommen wird vom Parlament (und im Falle eines Referendums) oder – sofern eine entsprechende Kompetenzdelegation vorliegt – vom Bundesrat oder vom zuständigen Departement oder Amt getroffen. Die verfassungsmässigen Zuständigkeiten und Verfahren inkl. Referendum werden also auch bei der dynamischen Rechtsübernahme vollumfänglichen eingehalten.
Hat die Schweiz über die dynamische Rechtsübernahme eine Pflicht, künftige Änderungen von aktuell bestehenden, aber nicht in den Anhängen des Stromabkommens aufgeführten EU-Rechtsakte zu übernehmen?
Nein. Die dynamische Rechtsübernahme darf den Geltungsbereich des Stromabkommens nicht ändern. Der Geltungsbereich des Abkommens ist in Art. 2 definiert und wird durch die in den Anhängen des Stromabkommens aufgelisteten Rechtsakte konkretisiert. Heute schon bestehende EU-Rechtsakte (wie bspw. die EU-Konzessionsrichtlinie, die EU-Dienstleistungsrichtlinie oder die EU-Wasserrahmenrichtlinie) hätten daher schon jetzt ins Abkommen aufgenommen werden müssen, um für die Schweiz mit Inkrafttreten des Abkommens oder später massgeblich zu sein. Möchte die EU später dennoch eine Aufnahme dieser Rechtsakte ins Stromabkommen, wäre das nicht ein Fall der dynamischen Rechtsübernahme, sondern eine Änderung des Abkommens, die von den Parteien neu verhandelt werden müsste.
Die Regeln zur Grundversorgung in der Schweiz sind nicht als Ausnahmen des Geltungsbereichs zum Stromabkommen festgelegt (keine Immunisierung). Könnte die Schweiz im Falle einer EU-Rechtsentwicklung, die eine Preisregulierung einschränkt oder verbietet, weiterhin ein Grundversorgungsmodell anwenden, das Tarifvorgaben macht?
Im Falle einer EU-Rechtsentwicklung in diese Richtung hätte die Schweiz über die dynamische Rechtsübernahme grundsätzlich die Pflicht, diese zu übernehmen, soweit sie auch mit den Zielen des Abkommens vereinbar wäre. Der Gemischte Ausschuss kann aber auch Anpassungen oder Präzisierungen an zu übernehmenden Rechtsentwicklungen vornehmen. Artikel 5 des Abkommens (Grundversorgung) bietet der Schweiz in diesem Zusammenhang eine gute Verhandlungsposition, denn er besagt, dass die Schweiz das Recht auf eine regulierte Grundversorgung mit regulierten Preisen hat. Abgesehen davon ist eine EU-Rechtsentwicklung in diese Richtung u.a. auch mit Blick auf die vergangene Energiekrise aktuell nicht erkennbar.
Sonstiges
Wären Staatsgarantien für Elektrizitätswerke noch möglich?
Muss die Schweiz mit einem Stromabkommen ihre kantonalen und kommunalen Stromversorgungsunternehmen aufteilen und privatisieren?
Kann das Paket ohne Stromabkommen in Kraft treten?
Aus Sicht des Bundesrats handelt es sich um ein Gesamtpaket. Entsprechend wurde mit der EU auch das Paket als Ganzes verhandelt. Der Bundesrat wird deswegen dem Parlament das Paket in einer einzigen Botschaft zur Genehmigung vorlegen. Er hat entschieden, das Paket auf vier Bundesbeschlüsse aufzuteilen. Einen Bundesbeschluss für die Stabilisierung des bilateralen Wegs, sowie je ein Bundesbeschluss für die neuen Abkommen zur Weiterentwicklung des bilateralen Wegs (Strom, Gesundheit, Lebensmittelsicherheit). Die Zustimmung zu den neuen Abkommen ist dabei rechtlich an die Zustimmung zur Stabilisierung des bilateralen Wegs geknüpft. Umgekehrt gilt dies nicht.
Trifft es zu, dass mit dem Stromabkommen ausländische Behördenmitglieder, z.B. von ACER, in der Schweiz tätig sein können?
Ja, aber nur äusserst eingeschränkt. Das Stromabkommen sieht in einzelnen Fällen einen direkten Informationsaustausch zwischen zuständigen Stellen der Schweiz und der EU, v.a. ACER, vor (vgl. Art. 40 Abs. 5 und 6 Stromabkommen). In Bezug auf Schweizer Unternehmen ist der direkte Informationsaustausch auf wenige Konstellationen begrenzt. Nicht vorgesehen ist hingegen ein Tätigwerden von EU-Beamten in der Schweiz im Sinne von Untersuchungsmassnahmen. Auch bei grenzüberschreitenden Fällen obliegen diese den Schweizer Behörden; EU-, bzw. ACER-Beamte können die Schweizer Behörde dabei begleiten.
Die allgemeine Regelung findet sich im erwähnten Artikel 40 des Stromabkommens. Zusätzlich wird in Anhang I mittels «technischen Anpassungen» präzisiert, durch wen und auf welche Weise Befugnisse ausgeübt werden. Der grösste Teil der Befugnisse liegt bei der Schweizer Regulierungsbehörde, der ElCom.